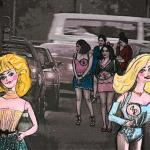Bo La Lot, Bacalhau und Injera – beim Schauen von Foodprints Hamburg läuft einem nicht nur das Wasser im Mund zusammen, sondern man erfährt auch jede Menge Interessantes über die kochenden Protagonist*innen. Diese erzählen – wie es Foodprints im Filmtitel schon erahnen lässt – unter anderem über ihre kulturellen Wurzeln, die Bedeutung von Essen und ihre Beziehung zu Hamburg. Außerdem zeigt der Film historische Zusammenhänge und spannende Fakten zum Thema Migration nach Hamburg.
Foodprints Hamburg – eine kulinarische Reise
Regisseur Mohammed Adawulahi und die Sängerin und Fotografin Anri Coza besuchen im Film zuerst die Schwestern Trinh und Trang. Beim Essen erzählen die Hamburgerinnen von ihrer Mutter, die aus Vietnam flüchtete und vom Rettungsschiff Cap Anamur gerettet wurde. Trinh und Trang kochen Bo La Lot (Rindfleisch in Lotusblättern), ein traditionelles vietnamesisches Gericht, das ihnen ihre Mutter beibrachte. Auch die Portugiesin Diana bereitet ein Familienrezept zu: Bacalhau, ein Kabeljaugericht. Sie kam ursprünglich mit ihrem Exmann nach Hamburg.
Salam,
schön, dass du da bist!
Wenn du den vollständigen Artikel lesen möchtest, melde dich hier kostenlos im Online-Magazin an: Einloggen.
Wenn du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos neu registrieren:Kostenlos registrieren.
Neben unseren Online-Artikeln erhältst du dann zusätzlich alle zwei Wochen den kohero-Newsletter mit spannenden Texten, Interviews und Hinweisen zu unseren Workshops und Veranstaltungen. Viel Freude beim Lesen!
Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei der Anmeldung brauchst, melde dich per Mail an team@ kohero-magazin.de.
Shukran und Danke!
Deine kohero-Redaktion