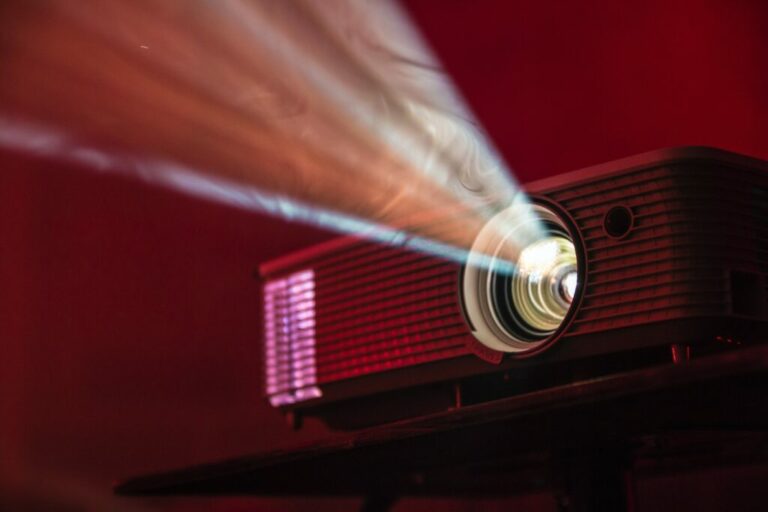Es muss eine Erinnerung geschaffen werden, um das Thema Migration wieder aus den Tiefen des Unterbewussten hervorzuholen. Vor allem in Bezug auf die Presseberichte, die die illegalen Pushbacks und persönlichen Schicksale spiegeln, braucht es ein wichtiges Medium, das dies anders thematisiert. Migration ist als Nicht-Betroffene*r zu weit von der eigenen Wahrnehmung entfernt. Es muss durch eine wahrnehmbare Perspektive herangeholt werden. Oft können Menschen sich mit Medien, wie z.B. Filmen, die persönliche Schicksale zeigen, besser identifizieren.
Wie die Sehnsucht nach einem Schiff der Anfang zu einer neuen Reise werden kann
Es ist eine Reise ins Unbekannte, die „Flotel Europa“ sollte für ein Kind und die Familie ein neues Zuhause sein. Man könnte denken, dass es sich hierbei um einen normalen und zugleich schönen Film handelt. Doch dies ist nicht der Fall.
Salam,
schön, dass du da bist!
Wenn du den vollständigen Artikel lesen möchtest, melde dich hier kostenlos im Online-Magazin an: Einloggen.
Wenn du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos neu registrieren:Kostenlos registrieren.
Neben unseren Online-Artikeln erhältst du dann zusätzlich alle zwei Wochen den kohero-Newsletter mit spannenden Texten, Interviews und Hinweisen zu unseren Workshops und Veranstaltungen. Viel Freude beim Lesen!
Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei der Anmeldung brauchst, melde dich per Mail an team@ kohero-magazin.de.
Shukran und Danke!
Deine kohero-Redaktion