Wenn Diktaturen stürzen oder Kriege enden, bleibt oft eine tiefe Wunde in der Gesellschaft zurück. Opfer fordern Gerechtigkeit, Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden und der Staat steht vor der Herausforderung, das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen. Genau hier setzt die Übergangsjustiz an. Durch Gerichtsprozesse, Wahrheitskommissionen und Entschädigungen sollen vergangene Verbrechen aufgearbeitet werden. Gleichzeitig sorgen Reformen dafür, dass sich solche Gräueltaten nicht wiederholen. Doch der Weg zur Versöhnung ist lang – und nicht jede Gesellschaft geht ihn erfolgreich.
Internationale Gerichte und Syrien: Hoffnung auf Gerechtigkeit nach Assads Sturz
Nach dem Sturz des Assad-Regimes nimmt die Aufarbeitung der Verbrechen in Syrien Fahrt auf. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Ahmad Khan, traf sich in Damaskus mit Übergangspräsident Ahmed Al-Shar’a, um über die juristische Aufarbeitung der Gräueltaten zu beraten.
Da Syrien unter der Baath-Partei den Internationalen Strafgerichtshof nie anerkannt hat, konnte dieser unter Assad nicht aktiv werden. Nun will die neue Regierung mit internationalen Justizbehörden zusammenarbeiten, um Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Besonders Folterer sollen vor Gericht gestellt und geflohene Verantwortliche ausgeliefert werden. Die Rolle internationaler Gerichte könnte damit entscheidend für die juristische Aufarbeitung in Syrien werden. Für viele Syrer*innen bedeutet Jusitz nicht nur Bestrafung der Täter, sondern auch die Anerkennung des Leidens, die Aufklärung der Schicksale der Verschwundenen und eine Chance auf politische und gesellschaftliche Reformen.
Ein Leben im Schatten der Folter
 Yasser Aljokhdar, ein 31-jähriger Master-Student im Fach Volkswirtschaftslehre (VWL) aus Düsseldorf, wurde 2013 vom Assad-Regime verhaftet, weil er sich für Menschenrechte und die Unterstützung der Opposition engagierte. Seine Geschichte ist eine von vielen, die das Regime geprägt hat – eine Geschichte von Folter, Verzweiflung und einem ständigen Kampf um Gerechtigkeit. „Ich wurde in eine Falle gelockt und brutal verhaftet. Die Verhörmethoden, die ich durchmachte, hinterließen tiefe Wunden. Ich wurde über Monate hinweg gefoltert. Nicht nur mein Körper wurde gebrochen, auch mein Geist.“ erzählt Yasser.
Yasser Aljokhdar, ein 31-jähriger Master-Student im Fach Volkswirtschaftslehre (VWL) aus Düsseldorf, wurde 2013 vom Assad-Regime verhaftet, weil er sich für Menschenrechte und die Unterstützung der Opposition engagierte. Seine Geschichte ist eine von vielen, die das Regime geprägt hat – eine Geschichte von Folter, Verzweiflung und einem ständigen Kampf um Gerechtigkeit. „Ich wurde in eine Falle gelockt und brutal verhaftet. Die Verhörmethoden, die ich durchmachte, hinterließen tiefe Wunden. Ich wurde über Monate hinweg gefoltert. Nicht nur mein Körper wurde gebrochen, auch mein Geist.“ erzählt Yasser.
Für die Verantwortlichen fordert er eine harte Strafe, die das Land über Jahre hinweg mit Gewalt regierten: „Es geht nicht nur um die Bestrafung der Täter, sondern auch um die Wiederherstellung der Würde der Opfer. Es ist entscheidend, dass das neue Syrien ein gerechtes Justizsystem etabliert, das endlich den Opfern Gerechtigkeit verschafft.“ Dabei gehe es nicht nur um die Justiz: „Entschädigungen und politische Reformen sind notwendig, um das Vertrauen der Menschen in die neue Regierung wiederherzustellen. „Das Volk muss sehen, dass seine Opfer anerkannt und das Leid der Menschen nicht ignoriert wird.“
Für Yasser ist Übergangsjustiz ein vielschichtiger Prozess: „Wahrheitskommissionen müssen das Schicksal der Verschwundenen aufklären. Wir können die Vergangenheit nicht einfach verdrängen. Es braucht eine rechtliche, aber auch gesellschaftliche Aufarbeitung der Verbrechen.“
Der Kampf für die Wahrheit
 Auch Mohamad Islim (30), Student im Fach Medizininformatik aus Essen, setzt sich für eine Übergangsjustiz ein. Während des Konflikts verlor er mehrere Verwandte und Freunde, die von den syrischen Sicherheitskräften gefoltert und ermordet wurden. Der Verlust und die Ungewissheit über das Schicksal seiner Angehörigen prägen seine Haltung zur Gerechtigkeit.
Auch Mohamad Islim (30), Student im Fach Medizininformatik aus Essen, setzt sich für eine Übergangsjustiz ein. Während des Konflikts verlor er mehrere Verwandte und Freunde, die von den syrischen Sicherheitskräften gefoltert und ermordet wurden. Der Verlust und die Ungewissheit über das Schicksal seiner Angehörigen prägen seine Haltung zur Gerechtigkeit.
„Gerechtigkeit bedeutet für mich nicht nur, die Täter zu bestrafen. Es geht auch um die Anerkennung des Leids, was den Familien zugefügt wurde – und um Entschädigungen. Wir müssen wissen, was mit unseren Liebsten passiert ist. Das sind die größten Schmerzen, mit denen wir leben müssen“, erklärt Mohamad.
Für ihn ist es unerlässlich, dass die Wahrheit ans Licht kommt: „Ohne Aufklärung über das Schicksal der Verschwundenen wird es keine wirkliche Versöhnung geben. „Es muss eine umfassende Wahrheit über das Regime und seine Verbrechen aufgedeckt werden.“ Mohamed lehnt jede Form der Versöhnung mit den Tätern ab: „Es gibt keine Versöhnung mit denen, die uns das Leben zur Hölle gemacht haben. Niemand darf der Strafe entgehen, egal welche Wahrheiten sie offenbaren.“ Für ihn geht es auch um das Vertrauen in die zukünftige syrische Regierung. „Wenn die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen werden, dann wird es für uns unmöglich sein, an das neue Syrien zu glauben.“
Im Schatten der Ungewissheit
 In Osnabrück erinnert sich der 30-jährige Student, Ahmad Anes Alshanbour, noch immer an die quälende Ungewissheit über das Schicksal seines Vaters, der 2012 während eines Besuchs in Damaskus vom Regime verschleppt wurde. Ahmeds Vater wurde wegen des Vorwurfs der „Terrorfinanzierung“ festgenommen, obwohl er keinerlei Verbindung zur oppositionellen „Freien Syrischen Armee“ hatte.
In Osnabrück erinnert sich der 30-jährige Student, Ahmad Anes Alshanbour, noch immer an die quälende Ungewissheit über das Schicksal seines Vaters, der 2012 während eines Besuchs in Damaskus vom Regime verschleppt wurde. Ahmeds Vater wurde wegen des Vorwurfs der „Terrorfinanzierung“ festgenommen, obwohl er keinerlei Verbindung zur oppositionellen „Freien Syrischen Armee“ hatte.
Der Damaszener beschreibt die vergeblichen Versuche, mehr über das Schicksal seines Vaters herauszufinden: „Wir haben alles versucht. Wir haben Berichte eingereicht, die Polizei kontaktiert, aber niemand konnte uns sagen, wo mein Vater ist. Bis heute haben wir keine gesicherten Informationen über sein Schicksal.“ Diese Ungewissheit ist für Ahmed und seine Familie eine Wunde, die nie schließt.
Wie Mohamed und Yasser fordert auch Ahmed die Rechenschaftspflicht für die Täter: „Es geht nicht nur um die Bestrafung der Verantwortlichen, sondern auch um das Recht auf die Wahrheit. Wir müssen wissen, was mit unseren Angehörigen passiert ist. „Solange wir keine Antworten bekommen, gibt es keine wirkliche Heilung für die Familien.“ Er plädiert zudem für die Bestrafung der Täter und auch für die Strafverfolgung der Unterstützer des Regimes, beispielsweise Journalisten und Künstler, die Propaganda verbreiteten und somit die Gewalt unterstützten.
„Ich wünsche mir ein Gesetz, das alle Anhänger des Assad-Regimes kriminalisiert und ihre Verfolgung weltweit ermöglicht. Ebenso sollte es strafbar sein, unser Leid und die Folter, die wir erlitten haben, zu leugnen. Die Täter dürften nicht ungestraft bleiben, und auch jene, die ihre Verbrechen rechtfertigen, dürften keinen Platz in Syriens Zukunft haben, fasst Ahmad seine Forderung zusammen.
Forderung nach der Übergangsjustiz: Ein gemeinsamer Ruf
Die Erfahrungen von Yasser, Mohamad und Ahmad zeichnen ein düsteres Bild von den Verbrechen, die unter dem Assad-Regime begangen wurden. Ihre Stimmen vereinen sich in der Forderung nach einer gerechten Aufarbeitung der Vergehen und einer umfassenden Übergangsjustiz. Für alle drei ist klar, dass der Weg zur Heilung nur über die Wahrheit und die Anerkennung des Leids führen kann. „Es gibt keine Alternative zu einer fairen Justiz“, sagt Yasser. „Sonst wird es zu Racheakten kommen, die das Land erneut in einen endlosen Krieg stürzen könnten.“
Mohamad Islim betont: „Die internationale Gemeinschaft muss eine aktive Rolle spielen, um sicherzustellen, dass die Übergangsjustiz tatsächlich umgesetzt wird. „Ohne externe Unterstützung wird es schwer sein, eine gerechte Aufarbeitung zu erreichen.“ Und Ahmed Al-Shanbour fügt hinzu: „Wir können nicht weitermachen, ohne zu wissen, was mit unseren Verwandten passiert ist. Wir müssen die Verantwortung für das, was geschehen ist, übernehmen, damit der neue syrische Staat auf eine echte Zukunft aufbauen kann.“
Doch dieser Gerechtigkeitsprozess erfordert mehr als nur rechtliche Schritte. Es ist eine gesellschaftliche und politische Herausforderung, die das Vertrauen in die zukünftige Regierung aufbauen und die Wunden der Vergangenheit heilen muss. Übergangsjustiz ist der Weg zu einer gerechten Zukunft, aber dieser Weg muss transparent, fair und umfassend sein. Für die Syrer*innen, die so lange unter der Tyrannei des Assad-Regimes litten, ist dies der einzige Weg zur echten Versöhnung.


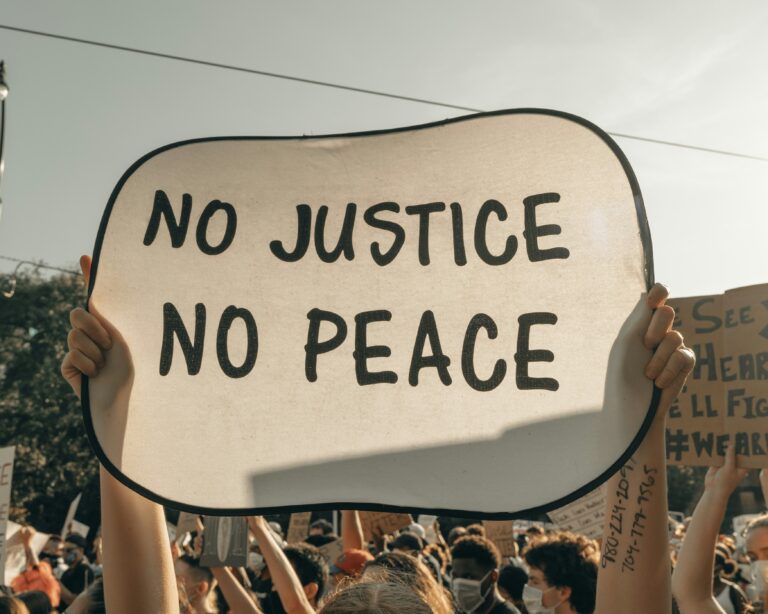






Eine Antwort