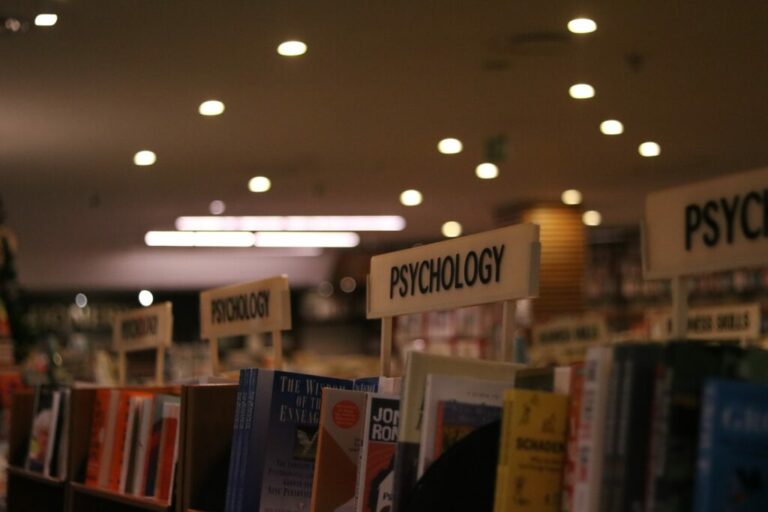Themen rund um die mentale Gesundheit sind mittlerweile in vielen Teilen der Gesellschaft angekommen. Auf TikTok in aller Munde, auf Instagram in vielen Infoposts nachzulesen sind Inhalte, die uns zum Nachdenken anregen, zum Reflektieren ermutigen und uns dazu bewegen sollen, in den Austausch zu treten. Dass Achtsamkeit, Empathie und Bedürfniswahrnehmung wichtig für uns selbst und das Miteinander sind, hören wir häufig. Auch, dass Psychotherapie zugänglicher sein sollte und der Platzmangel angegangen werden muss, ist bekannt. Psychotherapie für alle eben.
Aber auch 2023 ist es immer noch Fakt, dass das psychotherapeutische Versorgungssystem nicht darauf ausgelegt ist, den hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund – statistisch mehr als ein Viertel der deutschen Bevölkerung, Tendenz steigend – zu entlasten. Dabei gibt es Ansätze, die genau das versuchen.
Salam,
schön, dass du da bist!
Wenn du den vollständigen Artikel lesen möchtest, melde dich hier kostenlos im Online-Magazin an: Einloggen.
Wenn du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos neu registrieren:Kostenlos registrieren.
Neben unseren Online-Artikeln erhältst du dann zusätzlich alle zwei Wochen den kohero-Newsletter mit spannenden Texten, Interviews und Hinweisen zu unseren Workshops und Veranstaltungen. Viel Freude beim Lesen!
Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei der Anmeldung brauchst, melde dich per Mail an team@ kohero-magazin.de.
Shukran und Danke!
Deine kohero-Redaktion