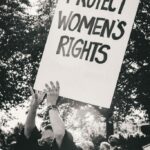Dave Rahimi und ich sitzen am Esstisch, der ordentlich mit Keksen, Tee und Kaffee bestückt ist. Seine Frau Susanne leistet uns Gesellschaft, schnell wird klar warum: Dave ist viel unterwegs, von Turnieren bis hin zu Meisterschaften sowohl national als auch international. Möglich wäre das in dem Umfang aber nur, verrät Dave, weil er mit Susanne jemanden gefunden hat, der ihn vollkommen unterstützt.
Aus Zusammenhalt werden Kämpfer geboren
Seit 25 Jahren ist das Ehepaar Rahimi nun ein eingespieltes Team und teilen sich dabei nicht nur Kinder, Haus und Hund, sondern auch dieselbe Leidenschaft, Kindern und Jugendlichen zu helfen. Für Dave sind es aber nicht die Ergebnisse, die er mit den Kindern und Jugendlichen bei Meisterschaften und Turnieren verzeichnen kann, die unter die Haut gehen, sondern der Zusammenhalt, den er immer wieder beobachten darf.
Salam,
schön, dass du da bist!
Wenn du den vollständigen Artikel lesen möchtest, melde dich hier kostenlos im Online-Magazin an: Einloggen.
Wenn du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos neu registrieren:Kostenlos registrieren.
Neben unseren Online-Artikeln erhältst du dann zusätzlich alle zwei Wochen den kohero-Newsletter mit spannenden Texten, Interviews und Hinweisen zu unseren Workshops und Veranstaltungen. Viel Freude beim Lesen!
Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei der Anmeldung brauchst, melde dich per Mail an team@ kohero-magazin.de.
Shukran und Danke!
Deine kohero-Redaktion