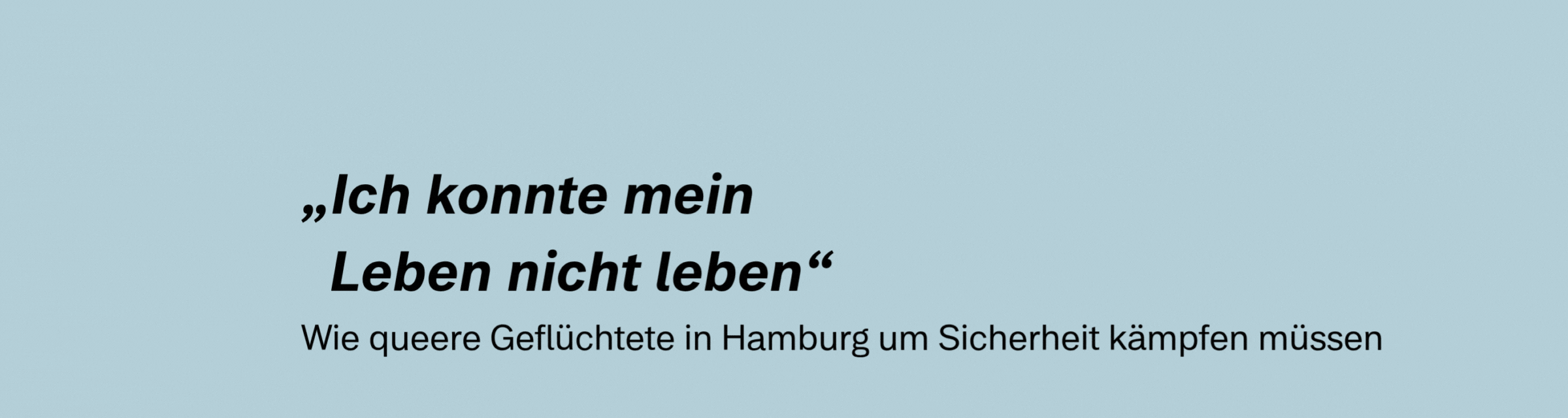Im Jahr 2021 hat ein Forschungsteam im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes das Forschungsprojekt Diskriminierungsrisiken und Diskriminierungsschutz im Gesundheitswesen vorgelegt. Das Ergebnis: Diskriminierungsrisiken gibt es sowohl im Zugang als auch in der Inanspruchnahme von gesundheitlicher Versorgung. Diskriminierungen wie Rassismus äußere sich nicht nur in Form von diskriminierendem Verhalten seitens des medizinischen Personals, sondern viel mehr durch institutionelle Praktiken und Abläufe, die ein ungleiches Behandeln von Patienten*innengruppen begünstigen würden.
Rassismus im Gesundheitswesen ist vielschichtig und betrifft Menschen auf vielen Ebenen. Manchmal richtet sich der Rassismus an das Personal im Gesundheitswesen, manchmal an die Patient*innen und manchmal kostet der Rassismus auch Leben, wenn dadurch verhindert wird, dass Krankheiten frühzeitig erkannt und richtig behandelt werden können.
Salam,
schön, dass du da bist!
Wenn du den vollständigen Artikel lesen möchtest, melde dich hier kostenlos im Online-Magazin an: Einloggen.
Wenn du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos neu registrieren:Kostenlos registrieren.
Neben unseren Online-Artikeln erhältst du dann zusätzlich alle zwei Wochen den kohero-Newsletter mit spannenden Texten, Interviews und Hinweisen zu unseren Workshops und Veranstaltungen. Viel Freude beim Lesen!
Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei der Anmeldung brauchst, melde dich per Mail an team@ kohero-magazin.de.
Shukran und Danke!
Deine kohero-Redaktion