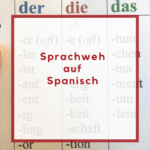Geflüchtete könnten zu einer Lösung für den nach Fachkräften lechzenden deutschen Arbeitsmarkt werden. Das ist zumindest die seit 2015 viel diskutierte Hoffnung. Die Deutsche Bahn hat ein großes Interesse daran, diese Hoffnung in die Realität umzusetzen. Als sich vor sechs Jahren die Bahnhöfe und Züge mit immer mehr Schutzsuchenden füllten, fragte sich der Konzern, was er leisten könnte.
„Wir sind schnell zu dem Schluss gekommen, dass wir qualifizieren, ausbilden und vor allem auch an den Arbeitsmarkt heranführen können. Dafür haben wir Expertise und Strukturen“, erklärt Ulrike Stodt, verantwortlich für die Integrationsprogramme bei der DB. Mit Strukturen meint sie u.a. das von der Bahn 2004 aufgebaute Berufsvorbereitungsprogramm Chance plus für Jugendliche ohne Ausbildungsreife. Der Konzern zögerte nicht lange und erweiterte das Programm speziell für die Bedürfnisse von Geflüchteten. Seit 2015 reserviert Chance plus ein Viertel seiner rund 300 Plätze für Geflüchtete, die nur ein Ziel haben: Ihre Wunsch-Ausbildung in Deutschland zu schaffen. Der gebürtige Syrer Mohammad ist einer von ihnen.
Salam,
schön, dass du da bist!
Wenn du den vollständigen Artikel lesen möchtest, melde dich hier kostenlos im Online-Magazin an: Einloggen.
Wenn du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos neu registrieren:Kostenlos registrieren.
Neben unseren Online-Artikeln erhältst du dann zusätzlich alle zwei Wochen den kohero-Newsletter mit spannenden Texten, Interviews und Hinweisen zu unseren Workshops und Veranstaltungen. Viel Freude beim Lesen!
Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei der Anmeldung brauchst, melde dich per Mail an team@ kohero-magazin.de.
Shukran und Danke!
Deine kohero-Redaktion