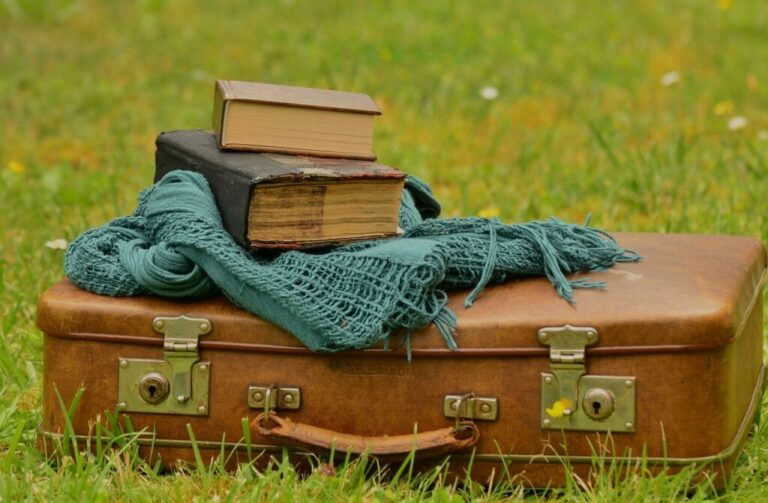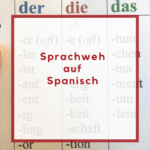Hanâ, Nurâ Sabah und Maja sind die vier weiblichen Figuren in dem gesellschaftspolitischen Roman „Fünfzig Gramm Paradies“ mit der Hintergrundkulisse des libanesischen Bürgerkriegs und den archaischen Überlieferungen von Ehre und Rache. Die Syrerinnen Hanâ und Nurâ, die kurdische Sabah aus der Türkei und Maja aus dem Libanon: vier starke, konsequente Frauen.
Der Roman mäandert zwischen den Biographien dieser vier Frauen mal im Erzählstil, mal in Tagebuchtexten und Briefen. Es mischen sich Länder, Kulturen und Schicksale: kollektive und individuelle. Und auch männliche Protagonisten kommen vor: Sijâd,(Majas verstorbener Mann), Schauki (Hanâs Liebhaber), Ahmed I und Ahmed II (Kurzzeit-Liebhaber und verschollenener Ehemann von Sabah und Kemal, Nurâs Geliebter).
Salam,
schön, dass du da bist!
Wenn du den vollständigen Artikel lesen möchtest, melde dich hier kostenlos im Online-Magazin an: Einloggen.
Wenn du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos neu registrieren:Kostenlos registrieren.
Neben unseren Online-Artikeln erhältst du dann zusätzlich alle zwei Wochen den kohero-Newsletter mit spannenden Texten, Interviews und Hinweisen zu unseren Workshops und Veranstaltungen. Viel Freude beim Lesen!
Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei der Anmeldung brauchst, melde dich per Mail an team@ kohero-magazin.de.
Shukran und Danke!
Deine kohero-Redaktion