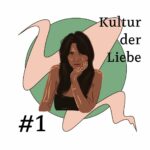Als meine Kollegin meinen Artikel über den Ramadan las, machte sie mich auf Chai Society aufmerksam. Chai Society brachte einen Podcast zum Thema Ramadan heraus, der sich mit der interessanten Frage auseinandersetzt, ob Ramadan “alamanisiert” wurde. Kürzlich habe ich diesen Podcast angehört. Sie sprechen über die konservative “oldschool“, die Ramadan so feiern möchten, wie er traditionell und in ihrer Erinnerung gefeiert wird. Im Gegensatz zu der “new school”, die offen für neue Formen ist.
Ich denke, dass dieser Streit mit der unterschiedlichen Erinnerung zusammenhängt. Auf der einen Seite steht die Erinnerung der Generation, die nicht hier geboren ist, sondern, so wie ich, erst als Erwachsene nach Deutschland gekommen sind. Sie haben viele Erinnerungen an die alte Heimat und die Familie. Auf der anderen Seite steht die Erinnerung der zweiten oder dritten Generation, die in Deutschland geboren oder als Kinder hierhergekommen sind. Ihre Erinnerungen beziehen sich auf Deutschland.
Salam,
schön, dass du da bist!
Wenn du den vollständigen Artikel lesen möchtest, melde dich hier kostenlos im Online-Magazin an: Einloggen.
Wenn du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos neu registrieren:Kostenlos registrieren.
Neben unseren Online-Artikeln erhältst du dann zusätzlich alle zwei Wochen den kohero-Newsletter mit spannenden Texten, Interviews und Hinweisen zu unseren Workshops und Veranstaltungen. Viel Freude beim Lesen!
Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei der Anmeldung brauchst, melde dich per Mail an team@ kohero-magazin.de.
Shukran und Danke!
Deine kohero-Redaktion