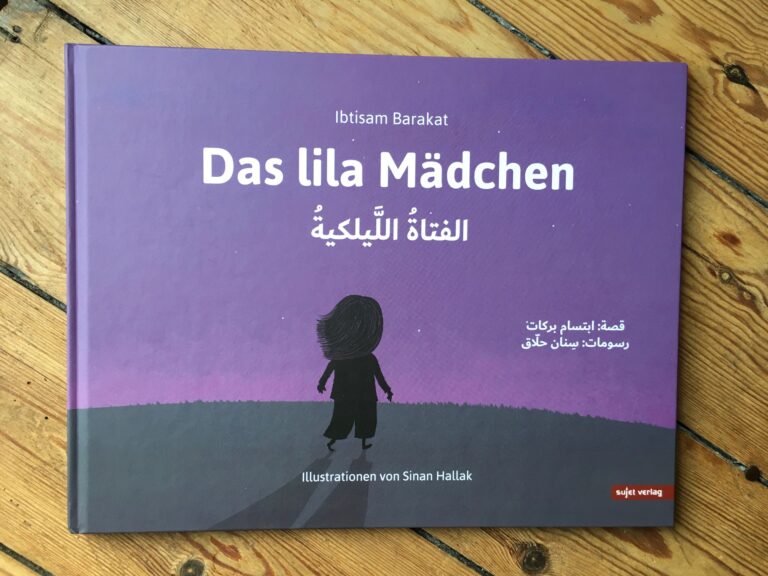Für den Sujet-Verlag, der in Abgrenzung zum eher negativ konnotierten Begriff der Exilliteratur von „Luftwurzelliteratur“ spricht, passt diese vielschichtige Erinnerung an Schmerz und Heilung gut ins Programm. Luftwurzeln bleiben nicht an Grenzen verhaftet, sondern wachsen über sie hinaus. Sie verankern sich nicht nur an einem Ort, bleiben beweglich, lebendig und reagieren auf ihre Umwelt. Auch Menschen schlagen Luftwurzeln. Sie reisen, wandern aus, flüchten. Sie lassen ihre Heimat hinter sich und finden eine neue.
Madjid Mohit, der aus einer iranischen Verleger-Familie stammt, ist 1990 als politischer Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er hat den Verlag in Bremen gegründet. Bei dem Buchmesse-Interview formulierte er noch eine weitere Beschreibung für die Literatur, die ihm am Herzen liegt: Luftwurzeln finden ihre Nahrung in der Erde wie in der Luft.
Salam,
schön, dass du da bist!
Wenn du den vollständigen Artikel lesen möchtest, melde dich hier kostenlos im Online-Magazin an: Einloggen.
Wenn du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos neu registrieren:Kostenlos registrieren.
Neben unseren Online-Artikeln erhältst du dann zusätzlich alle zwei Wochen den kohero-Newsletter mit spannenden Texten, Interviews und Hinweisen zu unseren Workshops und Veranstaltungen. Viel Freude beim Lesen!
Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei der Anmeldung brauchst, melde dich per Mail an team@ kohero-magazin.de.
Shukran und Danke!
Deine kohero-Redaktion