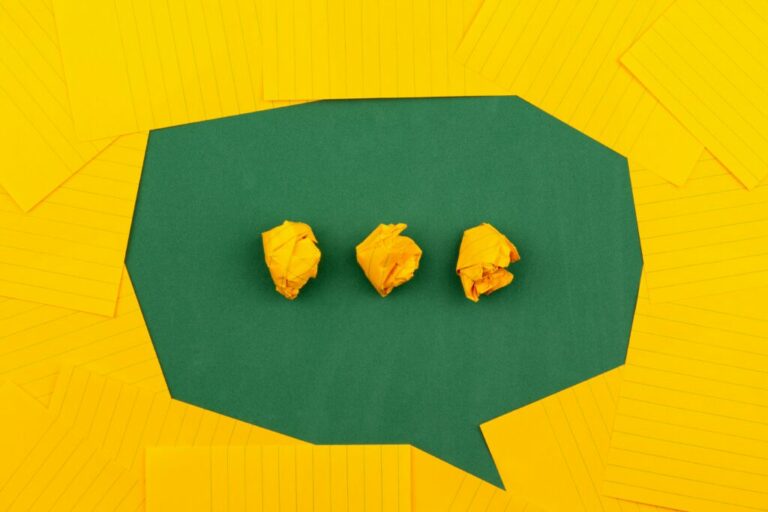Über 1,2 Millionen Geflüchtete sind im letzten Jahr nach Deutschland gekommen. So viele wie selbst 2015 nicht. Das liegt vor allem an dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine; eine Millionen Ukrainer*innen haben über das letzte Jahr in Deutschland Schutz gesucht. Durch den Einsatz der EU-Massenzustrom-Richtlinie wurde ihnen die Einreise erleichtert – eine Maßnahme, die zum ersten Mal zum Greifen kam. Andere Geflüchtete kamen vor allem aus Syrien, Afghanistan und Iran. 2020 und 2021 waren die Grenzen wegen der Corona-Pandemie geschlossen, deutlich weniger Asylsuchende erreichten Europa.
Doch jetzt nehmen die Zahlen wieder zu. Und die Debatte um Flucht und Asyl nimmt damit einen deutlichen Aufschwung. Die anfängliche Willkommenskultur scheint verflogen. Am Montagabend diskutierten zum Beispiel in der ARD-Sendung „Hart aber fair“ der flüchtlingspolitische Sprecher von ProAsyl Tareq Alaows, CDU-Politiker Jens Spahn, Grünen-Politikerin Britta Hasselmann, Landrätin von Regensburg Tanja Schweiger und Journalistin Isabel Schayani über die Flucht nach Deutschland.
Salam,
schön, dass du da bist!
Wenn du den vollständigen Artikel lesen möchtest, melde dich hier kostenlos im Online-Magazin an: Einloggen.
Wenn du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos neu registrieren:Kostenlos registrieren.
Neben unseren Online-Artikeln erhältst du dann zusätzlich alle zwei Wochen den kohero-Newsletter mit spannenden Texten, Interviews und Hinweisen zu unseren Workshops und Veranstaltungen. Viel Freude beim Lesen!
Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei der Anmeldung brauchst, melde dich per Mail an team@ kohero-magazin.de.
Shukran und Danke!
Deine kohero-Redaktion