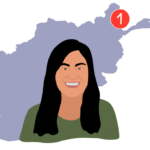Ein Fischerboot mit 750 Menschen an Bord ist am Mittwoch vor Pylos in Seenot geraten und gekentert. Das Boot kam aus Libyen, die Flüchtenden wollten wahrscheinlich über die Mittelmeer-Route nach Italien. Nur rund 100 von ihnen konnten gerettet werden. Viele werden noch vermisst. Bereits am Dienstag wurde das überfüllte Fischerboot lokalisiert. Die griechischen Behörden hätten sofort handeln müssen. Stattdessen sei es stundenlang nur beobachtet worden. Die Küstenwache behauptet, die Menschen auf dem Fischerboot hätten jede Hilfe abgelehnt. Das Boot habe nach Italien weiterfahren wollen, so der Sprecher der griechischen Küstenwache.
Bamdad Esmaili berichtet für den WDR aus Griechenland über das, was später viele als “Unglück” bezeichnen, seinem Kollegen gegenüber hätten mehrere Überlebende unabhängig voneinander berichtet, dass von der griechischen Küstenwache versucht wurde, das Boot mit den flüchtenden Menschen in italienische Gewässer zu ziehen: Das Boot wurde gepushbackt. So kam es den Berichten nach zu der Katastrophe.
Salam,
schön, dass du da bist!
Wenn du den vollständigen Artikel lesen möchtest, melde dich hier kostenlos im Online-Magazin an: Einloggen.
Wenn du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos neu registrieren:Kostenlos registrieren.
Neben unseren Online-Artikeln erhältst du dann zusätzlich alle zwei Wochen den kohero-Newsletter mit spannenden Texten, Interviews und Hinweisen zu unseren Workshops und Veranstaltungen. Viel Freude beim Lesen!
Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei der Anmeldung brauchst, melde dich per Mail an team@ kohero-magazin.de.
Shukran und Danke!
Deine kohero-Redaktion