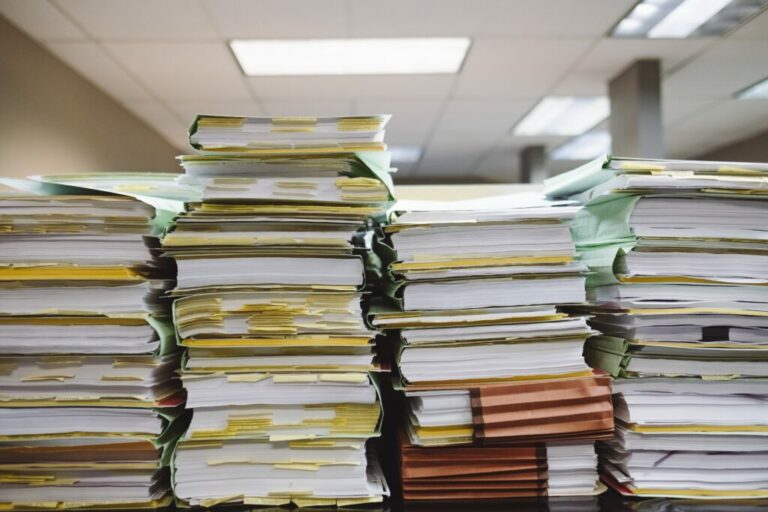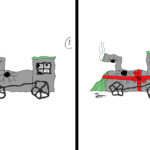Erstmals ist ein Lagebericht zu Rassismus in Deutschland erschienen. Verantwortliche ist die Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung, Frau Alabali-Radovan. Der Lagebericht trägt den Titel: „Rassismus in Deutschland: Ausgangslage, Handlungsfelder, Maßnahmen“. Erscheinungsdatum ist der 11. Januar 2023, womit die Veröffentlichung auf eine Zeit fällt, in der es sich beinahe erübrigt, auf die gesamtgesellschaftlichen Sorgen hinzuweisen – den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, die Post-Corona-Zeit, die Inflation und die Energiekrise. Doch gerade in Krisenzeiten müssen Betroffene von Rassismus und Diskriminierung besonders geschützt werden. Ob das der Fall ist, versucht der Lagebericht mit Hilfe von wissenschaftlichen Erkenntnissen, Daten zu Rassismusvorkommnissen und der Darstellung von Gegenmaßnahmen zu beantworten.
Analyse verschiedener gesellschaftlicher Handlungsfelder
Ausgangslage ist, dass Rassismus in Deutschland allgegenwärtig ist. Laut Umfragen erkennen 90% der Bevölkerung an, dass Rassismus ein Problem in Deutschland ist, und etwa zwei Drittel haben ihn selbst bereits direkt oder indirekt erfahren. Die Erscheinungsformen von Rassismus in Deutschland sind divers: es gibt Anti-Schwarzen Rassismus, Antimuslimischen Rassismus, Antiziganismus und Antiasiatischen Rassismus. Zudem existiert Antisemitismus, der als eigenes Phänomen mit Schnittmengen zum Rassismus gilt.
Salam,
bitte melde dich kostenlos an, um den vollständigen Text zu lesen. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich per Mail an team@kohero-magazin.de
Dank unserer kohero kommunity bleiben alle Inhalte kostenlos zugänglich. Wenn du an unsere Mission glaubst und uns dabei unterstützen möchtest, die Perspektiven von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte zu veröffentlichen, schließe hier deine Membership für kohero ab! Bis zum 1.7.24 brauchen wir 1.000 koheroes, die uns finanziell unterstützen. Und das geht bereites ab 5 € im Monat!
Shukran und danke!
Dein kohero-Team